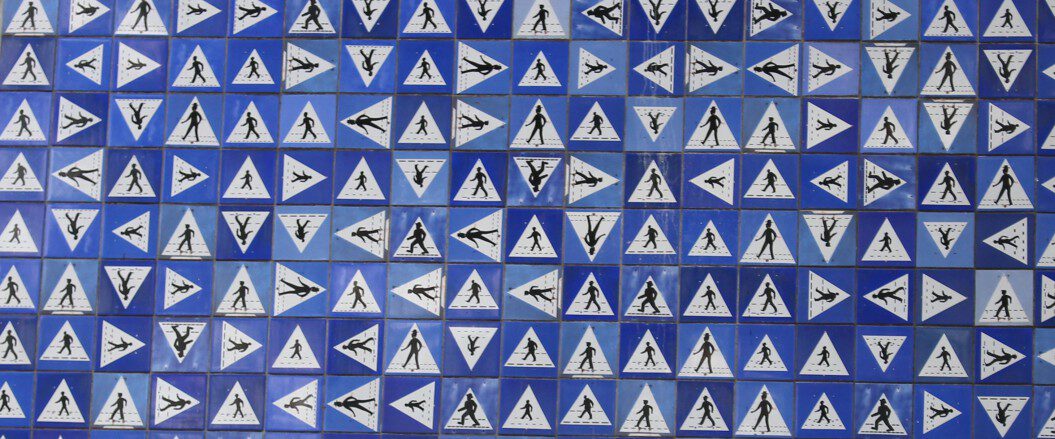Eher mangoorange und nicht stachelpostgelb sind die Deckel des Buches[1], gleichwohl ist es eine Zumutung, denn es beschäftigt sich mit der Frage, was ist, wenn Modernisierung und ihre Zeitläufe nicht mehr für die Demokratie einzahlen, die Demokratie womöglich gar nicht mehr demokratischer wird. Aber was kommt dann?
Im Zentrum von Blühdorns Perspektive steht das von ihm so genannte ökoemanzipative Projekt, also das Bündel aus Diskursen, Prozessen und Vorstellungen, das nach dem Ende der 1960er Jahre und dann mit etwas Macht seit den 1980er Jahren sich anschickte, das Politische umzugestalten. Dieses Projekt sei ins Schlingern geraten, meint Blühdorn, wegen seiner inneren Widersprüche. Auch deshalb würde gegenwärtig über Dinge gestritten, von denen man denken konnte, dass sie beschieden worden seien. Es sei zu einer disruptiven Repolitisierung der ökologischen Frage gekommen. Parteipolitisch macht sich diese heute mit der allenthalben anzutreffenden Grünenschmähung bemerkbar. Herausgebildet habe sich eine nachhaltige Nichtnachhaltigkeit, die Blühdorn besser mit dem Begriff der Unhaltbarkeit beschrieben sieht. Für Unhaltbarkeit sieht er der Nachhaltigkeit gegenüber einen semantischen Vorteil, weil diese anders als Nachhaltigkeit nicht mit einem Nimbus der Optionalität verbunden sei, denn Nichtnachhaltigkeit eines Arrangements bedeute schließlich nicht, dass es unmöglich sei, zumindest vorläufig an ihm festzuhalten (35).
Die im vorigen Absatz beschriebene disruptive Repolitisierung kommt mit der in westlichen Demokratien massenhaft sich verbreitenden Einsicht daher, dass möglicherweise doch mehr mehr sei und eben nicht weniger mehr, dass Ausgrenzung vielleicht gar nicht so schlecht sei, weil dann mehr für die Verbleibenden übrigbleibe (55). Aus Sicht einer ökoemanzipativen Perspektive neigen wir dazu, solch eine Entwicklung Rechtsruck zu nennen. Damit wären wir mit einem Rechtsruck konfrontiert, der in nur sehr geringem Umfang eine Widerkehr von Verdrängtem ist und stattdessen etwas sehr Jetziges an sich hat. Es ist eine Reaktion auf die bei Beck so genannte Zweite Moderne. D. h. der Reflex ist regressiv, aber keine Regression, die auf ein spätes 19. Jahrhundert schielt, wie der Faschismus der 1920er und 1930er Jahre, sondern eine, die die 1950erund bestenfalls noch frühen 1960erJahre im Auge hat, was sie kaum harmloser macht.[2] Jedenfalls der Glaube, der Pfad zum guten Leben sei mit Selbstbegrenzung gepflastert, ist wieder mehr zu einer Minderheitensache geworden. Vor diesem Hintergrund ist es mit jedem Jahr unwahrscheinlicher geworden, dass es zu der Transformation, von der das ökoemanzipative Projekt erzählt, kommen wird. Auch deshalb sieht kaum mehr jemand ein.
Die Krisenkonstellation durch die die westlichen Modernen gerade waten, bildet sich Blühdorn zufolge aus fünf Elementen: einer Krise des Kapitalismus (1), der ökologischen Krise (2), einer Krise der Demokratie aufgrund autokratisch-autoritärer Tendenzen (3), den Folgen der Künstlichen Intelligenz für die Autonomie des Subjekts (4) und dem Aufstieg Chinas (5).[3] Keine dieser Krisen ist insofern existenziell, dass Gesellschaft nicht mehr möglich sei, wenn sie nicht gut ausgehen, allerdings stellt sich in Hinblick auf jede von ihnen die Frage, wie Gesellschaft aussähe, wenn es richtig schlecht läuft. Mit anderen Worten, weiter gehen wird es wohl, wie wünschbar dieses Weiter allerdings sein wird, steht auf einem anderen Blatt. Und das gilt wohl selbst für die zweite Krise, denn die planetaren Grenzen, von denen wir hofften, dass sie unsere Gesellschaften schon irgendwie zur Vernunft bringen würden, sind ja kein absoluten sondern solche der Akzeptabilität. Wir werden ja nicht alle sterben, wenn die atlantische Zirkulation zusammenbricht, reichlich unangenehm wird es in dem Falle aber schon werden in Europa, für die weitaus meisten jedenfalls. Gutes Leben wird dann vermutlich, wie schon vor der Moderne, eine Sache sehr weniger Menschen sein, der Rest hingegen wird, wie dereinst ohne Versprechen einer besseren Zukunft und wachsenden Wohlstands auskommen müssen.
Vielleicht haben wir es auch deshalb mit einer Demokratiekrise zu tun. Demokratie hat sagt Blühdorn plötzlich ihr Problemlösungsversprechen verloren, mit ihrer bisherigen Demokratisierung ist sie vor allem komplizierter, nicht jedoch problemlösungskompetenter geworden. Ja, mitunter scheint das Gegenteil der Fall zu sein und Menschen entwickeln den Eindruck, dass Demokratie es zunehmend nichts mehr geregelt bekommt. Polarisierungsunternehmer*innen mit vor allem rechtspopulistischen Agenden versuchen daraus seit Jahren Nutzen zu schlagen.
Und dabei hilft die Digitalisierung der Diskursinfrastrukturen. Zwar sah es für einen Moment so aus, als sei mit Digitalisierung Demokratisierung verbunden z. B. weil sie Gatekeeperrollen untergrub und horizontaler Vernetzung Vorschub leistete, aber mittlerweile sind die Kehrseiten offenbar geworden: gesellschaftlicher Zusammenhalt ist prekärer geworden, politische Kultur ist durch soziale Medien eher negativ denn positiv tangiert. Algorithmische Fremdbestimmung, panoptische Überwachung und künstliche Intelligenz, all dies scheint nicht nur am Horizont auf, sondern ist schon da und pflügt bei der Gelegenheit eine ganze Reihe sozialer Felder um. Demokratie tue sich nicht leicht, auf die damit verbundenen Fragen die nötigen Antworten zu finden, womöglich ist das Zeitfenster, das es vielleicht mal gegeben hatte, da demokratisch etwas zu regeln, längst zugefallen (147).
Zumal es in China noch zugefallener sei, denn dorthin hat sich ein Zentrum globaler Technologieentwicklung verlagert. Vor allem ein Dinge ausspuckender Produktionskapitalismus, deren Produkte inzwischen überall auf der Welt sind, ist dort zu finden. Blühdorn meint, im westlichen Blick auf China reenacte sich der dahingeschiedene Ost-West-Konflikt aufs Neue, diesmal aber als innerkapitalistischer Konflikt. Das Chinaunterkapitel gehört in meinen Augen eher nicht zu den starken Passagen des Buches.
Die Zwischenbilanz, die Blühdorn vor seinem tiefen Eintauchen in den Beckschen Denkkosmos zieht verweist dann auch eher auf die Permanenz der Krisen. Nicht der Kapitalismus zerfalle, sagt er, sondern die Werte um ihn herum, auch bei der Umwelt würden die Vorstellungen gesellschaftlicher Akzeptabilität strittig. Die neue, künftige Moderne sei gar keine „nie dagewesener Freiheit für alle“, sondern eine jenseits westlicher Werte (162).
Und dann taucht Blühdorn zwei Kapitel lang in den Beckschen Denkkosmos ein (168 – 253). Beim Lesen fällt auf, wie sehr auch ich in diesem Kosmos gedacht habe, ohne selbst allzu sehr in Becks Büchern gelesen zu haben. Aber viele Leute, mit denen ich gearbeitet und über Jahre Gedanken ausgetauscht habe, waren da sehr drin, Sabine Hofmeister[4] z. B., um nur eine von vielen zu nennen. Und sehr viel von dem, was wir als transformative Wissenschaft kennen, all die Forschung die auf eine Transformation hinstrebt, ist einer Beckschen Denkwelt verhaftet. Nicht von ungefähr sind Becks zweite Moderne und das ökoemanzipative Projekt nur mit Mühe voneinander zu trennen.[5]
Bei der Frage, wie es weitergeht, landet Blühdorn bei drei Dialektiken: einer Dialektik der Nachhaltigkeit, einer Dialektik der Emanzipation und einer Dialektik der Demokratie. Nachhaltigkeit schien attraktiv, weil sie keinen Abschied vom Kapitalismus bedeutete, sie war damit politisch um so vieles pflegeleichter als andere Optionen, um viel besser verkaufbar als Postwachstum ohne Wachstum oder gar ohne Markt. Und Nachhaltigkeit war so konvenient postideologisch, denn sie setzte auf Verwissenschaftlichung, Technisierung und ein Entpolitisierungsversprechen (268f.). Auch dadurch sei Nachhaltigkeit zu einem empty Signifier[6] geworden.
Blühdorn sieht die seit einigen Jahren grassierenden alternativen Fakten als eine Nebenfolge des auf Verwissenschaftlichung setzenden Nachhaltigkeitsparadigmas, dem mit einem Reempowerment begegnet werde und er sieht auch eine Post-normal-Science mit an der Wiege dieser Entwicklung stehen. Nachhaltigkeit meint er, habe der Nichtnachhaltigkeit der Gesellschaft Zeit gekauft und sei deshalb, was die notwendige Transformation betreffe, nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Trotzdem sei das mit ihr verbundene Paradigma nicht gescheitert, sondern höchst erfolgreich darin gewesen, die Zeit bis zum finalen Zerfall des ökoemanzipativen Projektes zu überbrücken (280).
Einen der Zerfallsgründe sieht Blühdorn nun darin, dass im ökoemanzipativen Projekt eine Logik der Begrenzung auf eine der individuellen Entfaltung träfe. Die Begrenzungslogik, auch aus einer alten konservativ oder gar reaktionären Umweltbewahrungsidee stammend, hat es zunehmen schwer, gegen individuelle Entfaltungsbedürfnisse, die in der späten Moderne immer wichtiger werden, anzukommen. Dies ist die Dialektik der Emanzipation.
Die Dialektik der Demokratie schließlich ist eng mit der vorgenannten verbunden. Demokratie ist deshalb zu einem Legitimationsinstrument einer Politik der Nichtnachhaltigkeit geworden (311). Und heut kehrt sich das antirepublikanische Moment, das einst ausgehend von den Neuen Sozialen Bewegungen die repräsentative Demokratie herausforderte als rechtspopulistische, an einer Oberfläche wie eine Kopie der NSB aussehende Farce, gegen diese. Die Kopie reicht so weit, dass da eine eigene Wissenschaftssimulation geschaffen wird, um einem als repressiv wahrgenommenen Wissenschaftsmainstream eigene Expertise entgegenzusetzen. Vieles, was bis vor wenigen Jahren wie ein technisches Problem aussah, ist damit plötzlich wieder zu einem politischen geworden. Demokratie verliert auch damit an Effizienz und Problemlösungsvermögen, was wiederum auf die Konten populistischer Polarisierungsuntermehr*innen einzahlt.
Die Dialektik der Emanzipation schließlich verweist darauf, dass es mit einer Frage verbunden ist, wie es mit dem Kantisch inspirierten Aufklärungsprogramm weitergehen wird. Zuerst sei es um eine Besonderung der Individuen, eine Konstitution der Subjekte gegangen (a), dann um das Schleifen der dieser entgegenstehenden Hindernisse in den Strukturen der Gesellschaft im Sinne einer Selbstbehauptung dieser Subjekte (b), dann um die Entwicklung von Fähigkeiten, diesen Autonomieansprüchen Geltung zu verschaffen (c) und dann um die Vision, die Utopie, wohin das alles gehen soll (d) (283 f. und tabellarische Darstellung (300)).
In Hinblick auf das, was sich da als dritte Moderne herausbildet, fällt Blühdorns Prognose etwas vag aus. Transformative Nichhaltigkeitsliteratur sieht Blühdorn jedenfalls festgeklebt in einem Beckschen Idyll und er fragt sich auch, ob der im Rahmen der Dialektik der Emanzipation angeschnittene Steigerungszusammenhang auf Dauer gestellt sein kann und ob nicht vielmehr doch mit mächtiger, kompetenter werdenden netzwerkhaften Strukturen der Gesellschaft kollidieren könnte (351). So bleiben am Ende mehr Fragen als Klarheiten, was dem Text nur bedingt vorzuwerfen ist, weil genau wissen kann man es tatsächlich nicht. Blühdorn scheint bei all dem eher einem pessimistisch gestimmten Lager zuzuordnen zu sein.
Was Blühdorn da macht, gefällt auch nicht allen und interessanterweise ist Blühdornreaktanz eher links als rechts der Mitte der Literatur zu finden. Dies verwundert insofern kaum, weil für Rechte eine Dialektik der Emanzipation eher unproblematisch sein dürfte, denn Emanzipation für alle ist ihnen ohnehin kein allzu zentrales Anliegen. Sieghard Neckel in etwa wirft dann also Blühdorn vor, ungerechtfertigterweise das Individualisierungsstreben der Menschen zu einem Problem zu machen.[7] Er meint deshalb, Blühdorns Gedanken in das konservative bis gar reaktionäre Lager einordnen zu können.
Karl Werner Brand hat dann aber noch mehr aufgewandt.[8] Er setzt bei der Behauptung an, Blühdorn sage, dass die Wende zur Nachhaltigkeit „definitiv“ noch nicht begonnen habe (290) Brands Vorwurf läuft darauf hinaus, dass Blühdorn die Relevanz kapitalistisch und organisational induzierter Nachhaltigkeitshindernisse herunterspiele (291). Deshalb meint Brand auch, dass aktuelle Nichtnachhaltigkeitsphänomene wenig bis nichts mit Subjektivitäten der Einzelnen und umso mehr mit kapitalistischen und neoliberalen Strukturen und Strömungen zu tun hätten (298). Und das, was wir heute als Rechtspopulismus wahrnehmen, sei gar nicht auf Ersteres stattdessen vollumfänglich auf Letzteres zurückzuführen.
Neckel und Brand sind nicht die einzigen, denen es mit Blühdorns Texten so geht. Wer sucht, findet auf Bluesky einen von seiner Autorin so titulierten Hateread von Blühdorns Monographie, die dort als „Schwall ins All“ klassifiziert wird. Man kann das so sehen, aber muss man? M. E. nicht, auch, wenn es Blühdorn seinen Kritikern in mancherlei Hinsicht etwas leicht macht, wegen einer gewissen Vagheit und Opazität seiner Gedankenachitekturen oder seiner Neigung zum Selbstzitat. Auch hat der Text nicht die kristalline Stringenz, die gute philosophische Arbeiten auszeichnet, sondern nimmt hier und da dann doch eher die für politikwissenschaftliche Texte manchmal übliche Melange aus Verkürzen und Schleifenziehen in Anspruch. Blühdorns Text ist insofern stellenweise länger als er sein müsste, und dann mitunter vager, als er sein sollte. Gleichwohl stellt er Fragen, die es lohnt, gefragt zu werden.
[1] Vergl. https://www.suhrkamp.de/buch/ingolfur-bluehdorn-unhaltbarkeit-t-9783518128084.
[2] Eine solche Stegreifhypothese würde auch die rechts der Mitte fast schon pathologische Negativfixierung auf Grüne erklären, die dadurch einmal mehr, diesmal im negativen Sinne als Partei der Zweiten Moderne Becks markiert wären.
[3] Vergl. dazu auch die von Peter Wagner geschriebene Rezension auf Soziopolis. Url: https://www.soziopolis.de/zeitenwende-einmal-anders.html, Zugriff am 02.20.2024.
[4] Vgl. https://econpapers.repec.org/bookchap/zbwarlfob/15.htm.
[5] Ich selbst habe vor Jahren meine aus heutiger Sicht vielleicht etwas technokratisch anmutenden Überlegungen in Sachen anthropozänkompatibler Wissenschaft und Politik mich in diesem Kosmos bewegt, ohne dass das da explizit stünde. Vgl. https://www.ingentaconnect.com/content/oekom/gaia/2015/00000024/00000003/art00005?crawler=true&mimetype=application/pdf und https://sciencepolicyaffairs.de/anthropozaene-politik-eine-politikwissenschaftliche-gedankenskizze/.
[6] Vgl. Brown, Trent (2016). Sustainability as empty signifier: its rise, fall, and radical potential. Antipode: a radical journal of geography, 48 (1), 115-133.
[7] Sieghard Neckel (2020): Der Streit um Lebensführung. Nachhaltigkeit als sozialer Konflikt; in: Mitttelweg Jahrg. 36/Heft 6, S. 82 – 100, S.87.
[8] Karl-Werner Brand (2021): Das schwarze Loch der „Nicht-Nachhaltigkeit“. Eine kritische Auseinandersetzung mit Ingolfur Blühdorns Forschungsansatz; in: Berliner Journal 31, S. 279 – 307.