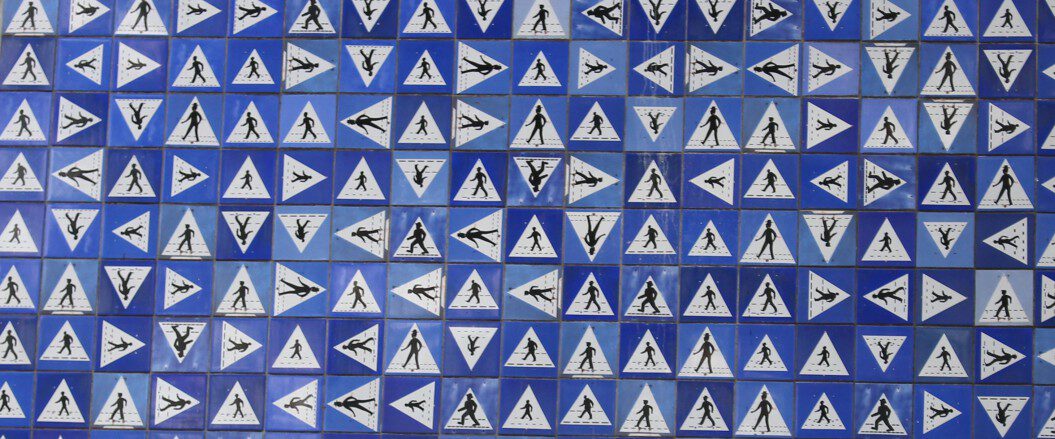Das Potential von #IchbinHanna bestand darin, Akteure des hochschulpolitischen Feldes für einen Sommer daran gehindert zu haben, nicht über Arbeitsbedingungen von Wissenschaftler*innen ohne Professur zu sprechen. Einen Sommer lang und vielleicht auch noch den darauffolgenden Winter war es nicht möglich, Misshelligkeiten der Arbeitsbedingungen in der Wissenshaft, die Absurditäten des uferlos gewordenen Qualifikationsbegriffs beiseitezuschieben und zu verbergen, dass die Debatte über selbige Arbeitsbedingungen und Karrierewege eigentlich wenig mehr als ein um sich kreisender Verschiebebahnhof der Verantwortlichkeiten war. Damit ist es nun leider, seit dem Frühsommer etwa, vorbei. Das Thema liegt, wie man weiß schon etwas länger auf der hochschulpolitischen Agenda, aber bisland war die HRK recht erfolgreich darin, es auf die gaanz lange Bank zu schieben.
Den Anfang der Renormalisierung machten, wenn auch unfreiwillig, die Gewerkschaften. Wie hätten auch ausgerechnet sie mit dem (aus ihrer Sicht Umstand) etwas anfangen können, dass #ichbinHanna eben keine weitere Mittelbaubewegung war, die sich über Arbeitsbedingungen und prekaritätsanfällige Karrierewege in der Wissenschaft beklagte. Also machten sie, was sie immer tun, unterstützten nach Kräften und wirkten dabei an dem Bild mit, dass #IchbinHanna eben doch das Übliche sei.
Die HRK scheint, wie sich gezeigt hat, diese Anregung der Gewerkschaftsseite durchaus dankbar aufgenommen zu haben. In einem Vorabinterview zum eigenen Vorschlag im Juni bei Jan-Martin Wiarda hatten Anja Steinbeck und Peter Andre Alt ihre Vorstellungen einer Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes skizziert. Und das kurz danach veröffentlichte Papier der HRK zeigte, dass sie nicht zu viel versprochen hatten. Dabei setzt der HRK-Vorschlag bei der sinnvollerweise immer wieder geäußerten Kritik an, dass Entscheidungen, ob jemand im Wissenschaftssystem verbleiben kann oder besser was anderes machen soll, zu einem möglichst frühen Zeitpunkt fallen sollten. Sie schlagen vor, statt der zweimal sechs Jahre, für die mit Qualifikation begründete Befristung möglich ist, nur noch einen zehnjährigen Zeitraum vorzusehen. Begründet wird dieser Vorschlag damit, dass es schließlich Fächer gebe, in denen die Promotion schneller zu erreichen sei, dafür aber längere Post-Doc-Phasen zu durchlaufen seien. Das kam, wie den Reaktionen auf Twitter zu entnehmen war, nicht überall gut an und macht sich erkennbar die Gelegenheit zunutze, auf #ichBinHanna zu reagieren, wie man immer zu reagieren pflegte. Bezeichnenderweise ergehen sich Steinbeck und Alt in politischer Rabulistik, wenn es darum geht klarzustellen, wie groß der Anteil der Befristeten an der Gesamtheit der Inhaber:innen wissenschaftlicher Stellen ist. Ersichtlich geht es ihnen dabei darum, einen Eindruck zu erzeugen, dass so groß ein Reformbedarf doch gar nicht sei und mit dem von Alt schon häufiger vorgeschlagenen Kniff, die Tenure Professur zum Regelfall werden zu lassen, gelöst werde könne. Dass die Anzahl verfügbarer Stellen für Tenure Professuren und sich dafür interessierender Promovierter mit Berufungsaussichten in einem unglücklichen Verhältnis zueinander steht, erwähnt er – wie so oft – auch in Wiardas Interview nicht. So ist der Vorschlag der HRK auch nicht als einer gemeint, der Probleme wissenschaftlich Beschäftigter lösen will, sondern eben nur die eigentlich reformunwilliger Hochschulleitungen. Wichtig ist es dabei eine Oberfläche zu erzeugen, die es jedenfalls nicht erlauben soll, dass irgendwer sagt, „die machen ja gar nichts“.
Der Vorschlag der Jungen Akademie ist da ganz anders gemeint und auch wenn seine Realisierungsaussichten weit geringer sind, also eher nicht davon auszugehen ist, dass er Wirklichkeit wird, hat er zur Welt etwas beizutragen, nicht zuletzt auch deshalb, weil es der elaborierteste und detaillierteste der derzeit vorliegenden Vorschläge ist. Der JA-Vorschlag sieht auf einen ersten Blick ähnlich wie der der HRK aus, denn er sieht vier Stufen wissenschaftlicher Beschäftigung vor. R1 meint eine Promotionsphase, R2 den Postdoc, R3 Senior Postdocs und R4 professorale oder pofessoralebenbürtige Beschäftigung. Für R1 wollen sie Beschäftigungsangebote, die die gesamte Dauer der Promotion abdecken und vor allem an dieser Dauer nicht an irgendwelchen mit den betreffenden Promotionen gar nichts zu tun habenden Projektzyklen orientiert sind. Für Promotionen soll einerseits eine Höchstbefristungsdauer von sechs Jahren gelten, aber anders als heute, sollen sich die Organisationen mit den tatsächlichen Promotionsdauern in den Fächern auseinandersetzen, also auch wissen, wie lange es dauert, in welchem Fach zu promovieren.
Für die R2-Phase möchte die Junge Akademie den Tatbestand Qualifikation als Befristungsgrund gestrichen sehen und das, was man sich in dieser Phase aneignet nicht im Kontext von Qualifikation, sondern in einem von Weiterbildung sehen. Das ist auch weit logischer als der Status quo, denn welche formale Qualifikation sollte denn nach der Promotion noch kommen, wo die Habilitation nicht mehr ohne weiteres und überall Standard ist? Schließlich erwirbt man in dieser Phase der Berufsbiographie eigentlich nur noch Fertigkeiten, die für die Wissenschaft und sonst nichts qualifizieren. Nimmt man für diesen Kontext Wissenschaft als Beruf, dann ist das berufsbefähigend, was da passiert. Dieses sich Weiterbilden hört im Übrigen auch dann nicht auf, wenn jemand eine unbefristete Stelle ergattert hat. In dieser Stufe sollen Zweijahresstellen vergeben werden und in der gleichen Institution einmal verlängert werden können, bei einem Wechsel der Institution sollte das wieder möglich sein. Als Regelzeit für den Verbleib in dieser Kategorie sollten 4 bis 6 Jahre gelten. Für R2-Stellen soll ein Richtwert gefunden werden, wie hoch in dieser Kategorie der Anteil befristeter Beschäftigung sein soll, bei Überschreitung sollte das auf Institutionenebene sanktioniert werden.
R3 ist dann die Stellenkategorie für die mit einem international wahrnehmbaren Profil. Bei denen ist die Entscheidung, ob man im Wissenschaftssystem verbleibt, gefallen, die Leute sind Nachwuchsgruppenleiter:innen, haben ERC-Grants eingeworben, oder eine W1-Professur. Ihnen soll eine dauerhafte Perspektive angeboten werden, die nicht unbedingt eine Professur beinhalten muss, aber gerne kann. Wer die vereinbarten Zielkriterien einlöst soll etwas bekommen, nicht automatisch, nicht ohne das Vereinbarte zu erreichen, aber doch verlässlich. Bei diesen Kriterien sollte es nicht, nicht in erster Linie um Quantitatives gehen. Gelöst werden soll mit diesem Modell auch das Problem, dass Nachwuchsgruppenleiter:innen heute gezwungen sind, jede Gelegenheit auf eine Professur oder andere unbefristete Beschäftigung zu gelangen wahrzunehmen, was für ihre Gruppen und deren Projekte epistemische und soziale Kosten aufwirft. Zudem kämen damit deutsche Universitäten besser in die Lage, aussichtsreichen Leuten vielversprechende Angebote zu machen.
Angewiesen ist der Vorschlag auf Departmentstrukturen nicht, nimmt aber charmanterweise an genau dem Punkt den Ball auf, an dem das Departmentmodell der Jungen Akademie ohnehin am stärksten war und das ist die Entbesonderung der Professur. Eine pragmatische Klassifizierung wissenschaftlicher Beschäftigungsoptionen nach der R-Skala würde tatsächlich helfen, die für das deutsche Hochschulsystem so prägende, sozial wie biographisch toxische Scheidung zwischen Professuren und anderen wissenschaftlichen Stellen zu überwinden. In zu vielen Forschungs- und noch mehr Anwendungskontexten (insbesondere in technischen) obwaltet die Annahme, dass, wer keine Professur habe, nicht gut sein könne. Das muss aufhören und Kooperationspartner:innen der Wissenschaft Gelegenheit geben, Forschung und Wissensproduktion von der Sache her und nicht von Titeln her zu beurteilen.
Für Institute und/oder Lehrstuhlinhaber bedeutet der Vorschlag der JA ein mehr an Personalentwicklung, damit einen erhöhten Aufwand. Leute, die heute auf irgendeine Art Nachwuchs genannt werden, bekommen ein erhöhtes Maß an Verantwortung und Selbstständigkeit, das eine oder andere Macht- und Abhängkeitsverhältnis sollte dadurch geschleift sein, das kann eigentlich nur gut sein.
Radikal aber ist der Vorschlag der JA deshalb, weil er Qualifikation nur für die Promotionsphase gelten lassen will und begrifflich nicht mehr auf Postdocs beziehen möchte. Alles, was nach der Promotion passiert, ist aus Sicht JA Weiterbildung denn es qualifiziert nur für den Forschungsbereich. Denn, fast nichts, was man sich auf dem Weg zu Meisterschaft in der Wissenschaft aneignet, ist auch außerhalb der Wissenschaft für Arbeitgeber*innen interessant.
Die Initiator*innen von #ichbinHanna gehen mit ihrem Vorschlag noch etwas weiter, haben ihn allerdings weniger ausgearbeitet. Qualifikation im Sinne eines Wissenschaftszeitvertragsgesetzes wollen auch sie eindeutig nur auf die Promotionsphase bezogen sehen, die generell vier Jahre, bei Möglichkeiten einer Verlängerung um zwei weitere zwei Jahre, dauern soll. Danach solle es die Möglichkeit einer mit Qualifikationszielen gerechtfertigten Befristung nicht mehr geben, weil, wie sie richtigerweise feststellen, Meriten, die man nach der Promotion erwirbt, nicht berufs-, sondern nur noch für die Wissenschaft, ja berufungsqualifizierend sind. Radikaler als die JA sind Bahr, Eichhorn und Kubon insofern, als sie die Befristung für Promovierte generell streichen wollen. Der auf die Professur ausgerichtete Wettbewerb, soll ihrer Vorstellung nach einem strategischen Kompetenzaufbau weichen, der die jeweiligen Fähigkeiten der Mitarbeiter*innen systematisch einsetzt.
Und auch Georg Jongmans, Coautor des Evaluationsberichtes zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz hat einen Vorschlag vorgelegt. Wie der Vorschlag der JA folgt Jongmans Vorschlag einem Phasenmodell. Jongmans schlägt eine Orientierungsphase für die ersten zwei Jahre nach der Promotion und eine Etablierungsphase für die vier Jahre danach vor. In der Orientierungsphase sollen die individuellen Karrierepotentiale eruiert werden, Ziel der Etablierungsphase ist es in der internationalen Fachcommunity Fuß zu fassen. Allerdings bleibt auch Jongmans vager, was Befristung nach der Promotion betrifft. Er möchte an die Etablierungsphase, die er um nicht verbrauchte Jahre aus der Promotionsphase gern verlängert sähe, eine Etablierungsphase von noch einmal vier Jahren anhängen, die dann auf eine dauerhafte Beschäftigung im Wissenschaftssystem vorbereiten soll.
Wie die Vorschläge der JA, Jongmans, Bahrs, Eichhorns und Kubons aufgenommen werden werden? Ich weiß es nicht, aber ein bisschen Spekulieren muss sein. Bei der HRK werden sie das alles nicht nicht so mögen, weil es Geld kostet, Transparenz schafft und einen unangenehmen Kontrast zum eigenen Vorschlag darstellt. Auch die Forschungsorganisationen werden mittelmäßig begeistert sein. Komplexer ist die Lage vermutlich bei der gewerkschaftlich motivierten Mittelbauvertreter:innenszene. Die werden finden, dass das nichts wirklich „Dauerstellen für Daueraufgaben“ sagt. Das ist einerseits eine verständliche Regung angesichts der praktischen Erfolglosigkeit der Formel, die ja schon vor 20 Jahren Sinn hatte, könnte es aber lohnend sein zu überlegen, ob nicht andere Storylines helfen könnten. Und auch in der Sache, es gibt weit weniger Dauerstellen als Leute, die gerne welche hätten und als organisational vermittelbare Gründe welche einzurichten.
Die Reaktionen auf den Vorschlag werden ein bisschen zeigen, wer wie Teil der Lösung und Teil des Problems ist. Ob das Abflauen des Momentums von #ichbinHanna tatsächlich daran liegt, dass ihre Vertreter*innen unwillig waren, die Auseinandersetzung mit den richtigen Gegnern zu suchen, kann ich nicht beurteilen, mindestens ähnlich plausibel ist die These, dass gerade das Wissenschaftssystem, wegen seiner Ausrichtung an wahrheitsorientierter Kommunikation wie kein anderes dazu in der Lage ist, Kritik zu inkorporieren. So ist es in der Lage, die Kritik seiner Personalverhältnisse als Wissenschaft zur Kenntnis zu nehmen und aus #ichbinHanna wird ein Buch bei Suhrkamp. Gleichwohl ist den Initiator:innen von #ichbinhanna nichts vorzuwerfen, was hätte auch eine klarere Benennung der HRK als Teil des Problems geändert?
Jedenfalls, die Ermahnungen, nun ja nicht zu viel von einer Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes zu erwarten, sie sind so typisch wie vorhersehbar. Denn das Gebaren von Hochschulleitungen ist das eine, das viel zur derzeitigen Situation beisteuert, tatsächlich haben sie ein starkes Interesse daran, dass die Dinge im Wesentlichen so bleiben, wie sie sind. Sie verteidigen das, was sie für Flexibilität und Handlungsfähigkeit halten, zur Not und immer wieder auf Kosten derer, die bereit sind als Wissenschaftler*innen ohne Dauerperspektive zu arbeiten. Die Politik ist aber die andere Seite des Problems. Schließlich hat sie ein starkes Interessse an einer Fortsetzung einer sich über Drittmittel artikulierender Forschungsförderung und Wissenschaftspolitik. Denn wie ließe sich besser Problembewusstsein kommunizieren und dabei Selbstwirksamkeit erleben?
Insofern wird der Erfolg einer Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes von zwei wesentlichen Komponenten abhängen.[1] Zum einen, ob es gelingt, auf die eine oder andere Weise, die Schlüsselstellung der Professur abzuschwächen, ihr andere dauerhafte Modelle dauerhafter Tätigkeit im Wissenschaftssystem an die Seite zu stellen: Lektor*innen, Wissenschaftskommunikator*innen, Dekansrollen, wie auch immer die Tätigkeiten dann heißen, wichtig ist es die zentrale, hierarchisch herausgehobene Rolle der Forschungsprofessur zu kontextualisieren. Damit soll auch die soziale Verarmung, die in den Universitäten durch das Schwinden der Vielfalt professoraler Rollenaspekte entstanden ist, aufgefangen werden. Denn nur dann, könnte es gelingen, die politischen und gesellschaftlichen Interaktionsbeziehungen des Wissenschaftssystem reicher zu gestalten.
Dann muss sich die Politik selbst vom Zwang drittmittelbasierter Forschungsfinanzierung befreien, was ihr immer noch schwerfällt, weil sie keine andere Sprache, keine anderen Formen hat, mit Wissenschaft zu interagieren als über Organisationen und Geld. Es braucht also neue Orte und Arenen demokratischer Interaktion von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Vielfältigere Karrieremodelle, wie man Wissenschaftler*in mit Dauerperspektive sein kann, würden die Entstehung solcher Arenen befördern. Es würde also die eine Reformnotwendigkeit der anderen in die Hände spielen. Das Drittmittelproblem und die Verengung der Hochschullehrer*innenrolle entpuppen sich damit als zwei Seiten ein und derselben Medaille.
Um diese Ziele zu erreichen, müssten Politik und Hochschulleitungen strategisch über die eigenen Schatten springen lernen und sich von einem Denken befreien, dass bei der Gestaltung von Beschäftigungsverhältnissen unterhalb der Professur vor allem die Minimierung von haushalterischen Risiken und Beschäftigungsrisiken im Auge hat. Wissenschaftsmanagement muss dafür feingranulierter und weniger formalistisch werden, mehr Wissen ansammeln, wie Wissensproduktion und Organisation von Hochschulen und wissenschaftlicher Arbeit miteinander in Wechselwirkungen stehen. Im Zentrum der Organisation wissenschaftlicher Arbeit sollte anders als heute sein, wie man Wissen gewinnt und was die Organisation für die Wissensproduktion tun kann und nicht, wie am sichersten Risiken als biographische bei den Betreffenden Mitarbeiter*innen abgeladen werden können.
[1] Vergl. dazu auch den m. M. n. guten Überbliksartikel von Thomas Thiel vom 12. August: https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/zeitvertragsgesetz-an-universitaeten-neue-reform-bis-jahresende-18230933.html